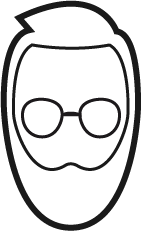Wie beeinflusst Bilderarmut die Wahrnehmung eines Ereignisses? Ein Kommentar zur Naturkatastrophe auf Tonga.
Einschätzungen zufolge ist die Explosion des Unterwasservulkans Hunga Tonga-Hunga Ha’apai nahe dem Inselstaat Tonga die wohl seit 30 Jahren weltweit massivste Eruption. Die (zumindest in Mitteleuropa) dünne Informationslage zu Beginn der Katastrophe über die Folgen des Ausbruchs wird - allenfalls für die hiesigen Mediengewohnheiten im vielfach propagierten visuellen Zeitalter - von einer ungewohnten Bilderarmut begleitet.
Und wenn das Wahrnehmbare aus dem Rahmen fällt, dann kann das Ausbleiben von Bildern die Bedeutung eines Ereignisses zerrinnen lassen. Wo etwas Extremes also nicht direkt vor unser Auge geführt wird - und damit das ästhetische Dokument ausbleibt -, scheint das Geschehene unter dem Radar unserer Aufmerksamkeit zu schwimmen. Und was nicht von einem breitem Publik aufgenommen werden kann, verliert in der ökonomischen Logik massenmedialer Berichterstattung leider auch zu oft seinen Nachrichtenwert.
“Jede Geschichte”, so schreibt W.J.T. Mitchell in seinem Buch ‘Das Klonen und der Terror. Der Krieg der Bilder seit 9/11’, “besteht in Wirklichkeit aus zwei Geschichten. Da ist einmal die Geschichte des tatsächlich Geschehenen und zum anderen die Geschichte der Wahrnehmung des Geschehenen. Die erste Art von Geschichte konzentriert sich auf Zahlen und Fakten, die zweite auf Bilder und Worte, die den Rahmen bestimmen, in dem Zahlen und Fakten erst ihre Bedeutung erlangen”.
Denken wir nur an die Geschehnisse des 11. September 2001: Der Falling Man, der wie ein Pfeil zwischen dem Süd- und dem Nordturm des ehemaligen World Trade Centers in die Tiefe stürzt, ist zur Ikone geworden. Die Bilder, die um den Globus zirkulierten, erzeugten Abscheu, Mitgefühl und Solidarität. Dabei ging es nicht mehr nur um die reine Dokumentation sondern vor allem um die Erzeugung markanter Bilder. Sie wurden Ausdruck neuer Kriege, die auf ungleiche, asymmetrisch gewordene Konfliktparteien zurückgehen und erzeugten so eine neue Realität, die zum weltweiten Krieg gegen den Terrorismus führte. Der Wegfall bildlicher Dokumentation, die verstrichene Möglichkeit, uns die Katastrophe in Tonga im wahrsten Sinne des Worte vor Augen zu führen, führt dann dazu, das sie lediglich einer Meldung unter vielen bleibt.
Seit der Bildberichterstattung über den 11. September 2001 verschwimmen auch immer wieder die Grenzen zwischen Fiktion und Realem, es kommt zu einer Ästhetisierung und zuweilen auch Ikonisierung des Grauens - im Fall der Naturkatastrophe in Tonga: Satellitenbilder des Ausbruchs erinnern an die ikonenhafte Darstellung eines Atompilzes (Hiroshima) -, mindestens aber zu einem auffallenden “Ereignischarakter” medial vermittelte Geschehnisse.
Durch Live-Erfahrungen sind mediale Übertragungen zu historischen, kollektiv prägenden und subjektiv miterlebten Ereignissen geworden. Zentrales Charakteristikum ist, dass die Medien das Ereignis nicht nur darstellen, sondern ein - in gewisser Hinsicht - funktionales Äquivalent anbieten. Sie schaffen eine narrative Struktur. An die Stelle vormals hierarchisch regulierter Perspektiven und Blickwinkel tritt nun das Primat medialer Partizipation, das nicht mehr auf die reine Belehrung und Lenkung abzielt, sondern auf ein sympathisches und emotionales Miterleben. Die Grenzen zwischen Fiktion und Dokumentation sind also wirklich unscharf geworden. Redakteure modellieren, transferieren und gestalten mittlerweile so, als wäre es eigens für diesen Zweck produziertes Bildmaterial. Fällt hingegen das Bildmaterial weg, so kommt es zu einer “Unsichtbarkeit des Faktischen”, das Geschehen gerät in Vergessenheit. Der Autor des Zeitartikels formuliert es etwas drastischer: “Wer Katastrophen vergessen machen will, muss Gewalt über deren Bilder erlangen”.
Unser Umgang mit Bildern ist also jedenfalls Teil einer gesamtgesellschaftlichen Selbstverständigung. Die vorherrschende kollektive Wahrnehmung eines Ereignisses wird eben auch durch immer neu auftretenden Bilder rekursiv angepasst. Das “gewohnte Bild” eines Ereignisses beinhaltet damit auch immer eine gewisse visuelle Erwartungshaltung. Die im Fall des Vulkansausbruchs in Tonga nach wie vor erkennbare Bildarmut avanciert somit zu einem ästhetischen Versprechen, zu einem Bild, welches uns immer noch gezeigt werden muss.
Das dadurch entstandene “Erwartungsvakuum” könnte - mit zunehmender zeitlicher Diskrepanz zwischen Bild und Ereignis - die Katastrophe quasi aus dem medialen Beobachtungsfokus kippen lassen. Selbst neues Bildmaterial wäre dann kaum in der Lage, Empathie und Unterstützungskräfte zu aktivieren - müssen die Medien einerseits doch bereit für eine Re-Aktualisierung sein und der Rezepient andererseits einem aktiven Sich-Wieder-Widmen zustimmen. Schlussendlich unterliegt aber auch die Energie, die wir in bestimmte Erwartungshaltungen investieren, einer zeitlichen Begrenzung.
Das ist auch der Grund, weshalb in den Medien zunächst mit “bildatmosphärischem Stopfmaterial” gearbeitet wurde. Gerade weil es sich um ein überaus tragisches und bedeutsames Ereignis handelte, durfte aufgrund des Ereignischarakters das bruchstückhaft Gemeldete nicht ohne Illustration bleiben. Manche Medien griffen reflexartig in die Archivkiste und untermalten das aktuelle Geschehen mit einer dramatischen Aufnahme eines im Jahr 2009 in der dortigen Region beobachteten Vulkanausbruchs. Noch bevor die Katastrophe also in seinem tatsächlichen Ausmaß zu begreifen war, wurde sie bereits in den Bereich der visuellen oder ästhetischen Fiktion gerückt. Auch deshalb finden später die wenigen vorhandenen Aufnahmen - quasi in Dauerschleife - Verwendung. Dazu gehört im Besonderen eine Satellitenaufnahme, die einen Moment während des Ausbruchs festhält - zeigt sich doch ein myzelartiges, weißes Gebilde, das an die Ikonografie eines Atompilzes zu erinnern vermag.
Das Wegbleiben erwarteter Katastrophenbilder - vor allem das persönlicher Schicksale - ergibt sich deren intensive Wirkung doch aus Abscheu und Anziehung zu gleich (vgl. Kant: Die Ästhetik des Erhabenen) - führt damit auch zu einem Fernbleiben einer sonst so gängigen Empathie- und Unterstützungswelle und verhindert auch noch das eindringliche Gefühl eines kollektiven Involviert-Seins. In jedem Fall geht es aber auch um den Wunsch, ein dokumentiertes Leid als unanzweifelbares Beweisstück für das jeweils Geschehene heranziehen zu können. Gleichzeitig gibt es uns die Rechtfertigung, die eigene Aufmerksamkeit auf das entsprechende Ereignis zu lenken.
Damit zeigt sich das ganze Dilemma: Die Aufteilung der eigenen Wahrnehmungs- und Aufmerksamkeitsressourcen - so schreibt der Autor des Zeitartikels durchaus scharfsinnig - ist zwar notwendig, aber damit auch hochgradig zynisch. Aufgrund der eigenen begrenzten Möglichkeiten erwächst unsere Schwäche für von Außen gesetzte Signale. Und ja, wozu haben wir unsere Augen? Wozu unser Gehör? Wozu den Geruchssinn oder die Berührungssensibilität unserer Haut? Es sind nämlich immer noch unsere Sinne, die die Inhalte der Welt von Außen in unser Inneres überführen. Unsere Sinne (und in höchstem Maße unsere visuelle Wahrnehmung) beeinflussen damit die Wahrnehmung wie auch die Bewertung unserer subjektiven Realität. Bilder sind dabei ein wirkmächtiges und vor allem ein nicht zu unterschätzendes Instrument. Und wo auch immer visuelle Kommunikation zum Einsatz gelangt, folgt sie einer eigenen, nicht rationalen, aber präsentativen und holistischen Logik.
Die Verteilung von Aufmerksamkeit ist somit ein ästhetisches, wie auch soziales - aber vor allem - ein politisches Instrument. Und ja, das wird es um so stärker, je mehr wir versuchen, den Umgang mit unseren Bildern auch zu reflektieren.
Link zum Artikel auf ZeitOnline vom 22.01.2022 - Tsunami ohne Bilderflut