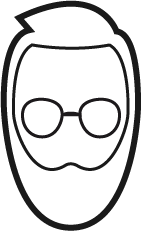Die Mediengesellschaft und ihre Bilder - eine ethische Betrachtungsweise visueller Kommunikation - Teil 2
Maßgeblich für das Verständnis, Bilder als wahrnehmungsnahes Zeichen aufzufassen, sind wiederum zwei Aspekte: Nämlich erstens der Zeichencharakter von Bildern und zweites der Wahrnehmungsbezug. Dem Zeichencharakter inhärent ist, dass einem kommunikativen Inhalt an eine kommunikative Trägersubstanz gebunden ist, was wiederum den Wahrnehmungsbezug, der durch eine entsprechende Beziehung motiviert ist, nach sich zieht. Kurz gesprochen: Ein Zeichen ist demnach nur dann als Bild zu verstehen, wenn ein irgendwie gearteter Inhalt zumindest teilweise aus einem Wahrnehmungsbezug entsteht.
Diese beiden Aspekte lassen sich freilich auch unabhängig in bildfremden Kontexten voneinander beobachten. Für ein Bild ist allerdings die Kombination beider Aspekte nötigt. Ein entscheidendes Kriterium für die Wahrnehmungsnähe sei demnach der Rekurs auf die Kompetenzen der Wahrnehmung, die im Hinblick auf die Interpretation bildlicher und inhaltszuweisenden Zeichen konstitutiv bleibt und somit die Bildträgerstruktur im Gegensatz zu arbiträren Zeichen zumindest einen Hinweis liefern kann, der auf die Bildbedeutung verweist. Dabei müssen wir allerdings immer auch eine erste Medienkompetenz besitzen, bei der freilich auch konventionelle Vorgaben mitschwingen, die uns dann erlaubt, zu verstehen, dass es sich um das Gezeigte um ein Bild handelt. Zur Bestimmung des Dargestellten können wir aber auf die wesentlichen Prozesse zurückgreifen, die wir aufgrund unserer Fähigkeit der Gegenstandswahrnehmung besitzen.
Dem Verständnis als Zeichen geht erstmal grundsätzlich ein symbolisches Erkennen voraus, wobei gleichzeitig dem wahrnehmungsnahen Zeichen per Definition eine Repräsentation des abgebildeten Gegenstands innewohnt und eine mehr oder weniger starke Verwechslungsreaktion auslöst. Diese Reaktion tritt in der Regel nicht direkt in Erscheinung, sondern wird als gemeintes Repräsentiertes innerhalb des Individuums wirksam. Demzufolge erfüllen die so bestimmten Zeichen das Kriterium einer Kontextbildung, was uns dazu führt, den Kontextbezug als grundlegende kommunikative Funktion des Bildgebrauch zu erachten. Auf abstrakter Ebene ist die elementare Aufgabe eines Bildeinsatzes eine Art der visuellen Charakterisierung. Wichtig: eine solche Charakterisierung kann durchaus über das reine Präsentieren perspektivisch gebundener Oberflächenansichten hinaus gehen.
Durch den Doppelaspekt der Zeichenhaftigkeit und der Wahrnehmungsnähe der Bilder ergeben sich für den Bildinhalt notgedrungen unterschiedlich Bedeutungsebenen in Bezug auf Inhalt, Referenz, symbolische Deutung und kommunikativen Stellenwert. Der Bedeutungsaspekt lässt sich dabei auf die visuellen Bildträgereigenschaften zurückführen und ist somit vor allem perzeptueller Natur und damit auch Ausgangspunkt für die übrigen Bedeutungsebenen. Fiktionale Bilder illustrieren entsprechend, dass der Bildinhalt nicht zwingend an einer Bildreferenz oder einem realem Bildreferenten hängt. Allerdings ist der Bildinhalt zur Bestimmung der Referenz eine notwendige, aber keinesfalls hinreichende Bedingung, die wiederum durch den Verwendungskontext spezifiziert werden muss. Um den symbolischen Gehalt eines Bildes (oder auch nur eines Bildelements) bestimmen zu können, ist die Erkenntnis des Bildinhalts und darüber hinaus die Kenntnis des soziokulturellen Kontextes notwendig. Die kommunikative Bedeutung – quasi die mit einem Bild zu vermittelnde Botschaft – erschließt sich mit dem Bildinhalt als notwendige Prämisse. Somit schließt ein Verständnis des kommunikativen Gehalts notwendigerweise den Präsentationszusammenhang sowie einen Rekurs auf kommunikative Maxime mit ein, die in weiterer Folge zum Erschließen der kommunikativen Intention dienen können.
Allerdings lässt sich prinzipiell nur kommunikativ bestimmen, inwiefern jemand in der Lage ist, mit sortalen Gegenständen umzugehen, da es lediglich dadurch und mit wechselseitiger Kontrolle möglich ist, stabilen Zugang zu einem nicht-anwesenden Kontext herzustellen. Dabei erfolgt der Verweis auf die Nichtanwesenheit, in dem ein Kommunikationspartner sich dem Gegenüber als jemand darstellt, der seine Aufmerksamkeit auf jenen Kontext und damit nicht nur auf die tatsächlich vorhandene Situation richtet. Damit ist gezeigt, dass das Richten der Aufmerksamkeit auf einen bestimmten Kontext eine kommunikative Handlung ist, die sich als zentral für unser Bildvermögen darstellt. Dabei sticht sofort ein weiteres Problem ins Auge: Die Rezeption der Aussage eines Bildes (da das Bild eine kommunikative Handlung darstellt) ist dann in direkter Folge abhängig von dem Modus, in dem der Rezipient ein Bild wahrnimmt.
Um diese These zu stützen und sie in einen übergeordneten systemischen Rahmen einzubinden und dadurch zu stärken, bietet sich ein Rückgriff auf den Systemtheoretiker Niklas Luhmann an, nach dem Kommunikation ein Prozessieren von Selektion in einem dreiteiligen Selektionsprozess darstellt.
Bevor es auf Seiten des Kommunikators also zu einer Selektion der Mitteilung kommt, also zu einer Entscheidung für eine Mitteilung bei gleichzeitiger Entscheidung gegen eine Vielzahl anderer Mitteilung, wird zunächst durch den selektiven Akt der Aufmerksamkeit auf Seiten des Kommunikators irgendetwas zu einer Information gemacht. Diese Aufgabe obliegt also dem Kommunikator. Im Gegenzug muss der Rezipient in einem dritten Selektionsprozess allerdings verstanden haben, dass es sich um eine Mitteilung handelt. Alsbald etwas als Mitteilung aufgefasst wurde, verstehe man, dass beim Kommunikator eine Differenz zwischen Information und Mitteilung vorliegt. Nur wenn dieser Unterschied verstanden wird, kann Kommunikation per se zustande kommen. Dabei ist allerdings jede Selektion kontingent. Sprich, möglich, aber nicht wesensnotwendig. Da jeweils zwei Seiten an einer kommunikativen Handlung beteiligt sind, wird auch von einer doppelten Kontingenz gesprochen, welche aufgrund einer angenommenen Unwahrscheinlichkeit von Kommunikation, allerdings nicht noch mehr Unwahrscheinlichkeit fördert, sondern einen Problemlösungsprozess in Gange setzt. Dabei geht es Luhmann aber zunächst nicht um inhaltliche Verständigung, sondern lediglich um die Beschreibung eines übergeordneten, grundlegenden kommunikativen Prozesses. Die Frage nach dem Inhalt ist also zunächst daran gekoppelt, ob Kommunikation überhaupt zustande kommt und obliegt offensichtlich dem Rezipienten. Sofern verstanden wurde, dass es sich um eine Mitteilung handelt und damit um einen kommunikativen Prozess, können wir uns auf einer untergeordneten Ebene dem inhaltlichen Verständnis widmen.
Da der Kommunikationserfolg vom Rezipienten abhängt, schreibe ich ihm auch die Deutungshoheit auf den Inhalt zu. Eine von einem Kommunikator intendierte inhaltliche Mitteilung kann demnach nicht zweifelsfrei und ohne Verlust von Information übertragen werden. Es obliegt dem Rezipienten, der aufgrund seiner sozialen Einbettung in gesellschaftliche Strukturen mit einem individuellen Wahrnehmungsverständnis ausgestattet ist, die Inhalte auf Basis und gleichzeitig mit Hilfe seiner Identität zu entschlüsseln und zu glauben, die Intention des Kommunikators auch inhaltlich verstanden zu haben. Doch damit wird es gefährlich. Denn mit diesem Verständnis fällt dem Kommunikator - vor allem in einem gesellschaftlichen Diskurs - die überaus wichtige Aufgabe zu, einen reflektierten und gleichzeitig möglichst unmissverständlichen Bildeinsatz zu verantworten.
Fortsetzung folgt.