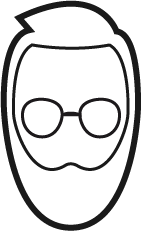Die Mediengesellschaft und ihre Bilder - eine ethische Betrachtungsweise visueller Kommunikation - Teil 1
Nichtsdestotrotz kann sich vermutlich jeder in folgende Lage versetzen: Um sich bei einem Freund oder seinem erweiterten Bekanntenkreis Respekt und Lob zu verdienen, damit also eine eigenständige, außergewöhnliche Identität aufzubauen, überschreitet man schon mal Grenzen. Grenzen in der Inszenierung, die für einen früher unpassierbar gewesen sind. Am Ende besänftigen wir uns nicht mal mehr mit Ausreden. Es zählt nur noch der Erfolg, die Inszenierung. Dabei entschwindet der Inszenierung schnell jegliche Moral und dabei auch die letztgültige Vorstellung irgendwie gerecht sein zu müssen. Wer sich damit von den Folgen seines eigenen Handelns befreit und diese auf das Kollektiv abwälzt, der neigt eher zu unmoralischem Verhalten. Spannend ist, dass dieses Phänomen auch auftritt, wenn der Mensch glaubt, die Gemeinschaft leide gar nicht an dieser Sittenwidrigkeit. Wer sich in diesem Dilemma befindet, der sitzt bereits in der moralischen Zwickmühle. Im Grunde ist es einem klar, dass sein eigenes Verhalten nicht korrekt ist. Doch statt sich der Lösungsfindung zu widmen, flüchten wir uns in Ausreden und recht fadenscheinige Begründungen. Sozialneid und Statusdenken führt uns Menschen in diese Verfehlungen. Irgendwann bedienen wir uns einer sogenannten Patchwork-Ethik. Einem Rollenwechsel, bei dem wir zwischen unterschiedlichen Wertesystemen hin- und herspringen. Plakativ gesprochen: tagsüber Betrüger, Intrigant und Mobber, abends treuer Familienvater, aufmerksamer Ehemann und hilfsbereiter Freund. In Wahrheit sind wir nur zu schwach für unsere Werte auch die entsprechenden Konsequenzen zu tragen. Dabei ist es inkonsequent über das System zu jammern und gleichzeitig ein Teil davon zu bleiben. Es liegt also immer in der Entscheidungsmacht des Einzelnen, wo er seine moralischen Grenzen zieht. Es kann demnach bereichernd und lehrreich sein, sich mit ethischen Fragen in der Verwendung von Bildern in unserer heutigen Mediengesellschaft zu beschäftigen und dabei eine eigene Perspektive zu entwickeln. Um dies aber schlüssig argumentieren zu können, ist weiter auszuholen und am Ende werden wir sehen, dass es hierauf keine eindeutige Antwort geben kann.
Beginnen wir mit den Argumenten von W.J.T. Michell, der das Sehen als kulturelles Konstrukt auffasst, welches erlernt und gesellschaftlich gewachsen ist. So steht es immer auch gleichzeitig in Beziehung mit der menschlichen Gesellschaft samt ihren ethischen, politischen, ästhetischen und epistemologischen Konzepten von Sehen und gesehen werden. Weitergedacht sind visuelle Bilder damit Vermittler in sozialen Interaktionen. Quasi Vorlagen, die unsere Begegnungen mit anderen Menschen strukturieren. Dabei besitzt das Bild an sich immer eine Zweideutigkeit: Es sei Instrument der Manipulation als auch eigenständige Quelle mit einer eigenen Bedeutung von Sinn und Zweck.
Unser Sehen passiert also in einer spezifischen räumlichen Wahrnehmungsanordnung, dem sogenannten Dispositiv, welches einen Betrachter so ausrichtet, dass seine Wahrnehmung durch die technisch-räumliche, institutionelle (als symbolische Verdichtung übergreifender gesellschaftlicher Strukturen) sowie machtgetriebene Rahmung maßgeblich bestimmt wird. Dementsprechend steht das Sehen (und selbstverständlich auch das Gesehen werden) in einem engen Zusammenhang mit unseren alltäglichen Diskurspraktiken, die wiederum selbst auf unsere kognitiven, emotionalen, affektiven und moralischen Bedingungen der Identität jedes einzelnen Kommunizierenden einwirken. Baudry und Hickethier gehen noch einen Schritt weiter: Durch die offenbar enge Verbindung der technischen Anordnung unserer Welt, unserer kulturellen Ritualisierung sowie unserer Wahrnehmung besitzt das Dispositiv weitgehende Auswirkungen auf unsere kulturellen Gewohnheiten und Gewissheiten. Dass die Leseweise eines Bildes in Abhängigkeit zum Wissen des Individuums und damit zu dessen Identität steht, wird auch durch den Semiologen Roland Barthes postuliert. Für eine wirkungsvolle Bildrhetorik müssen also passenden Konnotationssignifikante gefunden werden, die aber wiederum auch nur für einen gesellschaftlichen Bereich Gültigkeit besitzen können und im Umkehrschluss erneut das Wissen und die Identität der betrachteten Person beeinflussen. So entsteht ein Kreislauf, in dem das Sehen als Voraussetzung für die Erfahrung der Wirklichkeit dient, aber auch gleichzeitig auf die Identität jedes Einzelnen einwirkt und damit diese Erfahrung selbst beeinflusst. Entsprechend ist Bildlichkeit nicht als Wahrheit einzuordnen, sondern lediglich als ein mögliches Repräsentationssystem.
Dabei stehen die Medien (auf eine konkrete Definition wird hier verzichtet, da der Begriff des Mediums zu den terminologisch unklarsten und auch umstrittensten Begriffen der gegenwärtigen kommunikationswissenschaftlichen Diskussion zählt. Eine laienhafte Vorstellung des Begriffs ist daher angenommen) im Zentrum entsprechender Auseinandersetzung, denn realer Alltag und (massen)medial vermittelte Realitäten durch Bild und Ton vermischen sich zunehmend. Dabei verschwimmen die Grenzen zwischen realer Welt und massenmedialem Abbild weitgehend. Demzufolge fällt den Medien eine Schlüsselrolle bei der Strukturierung gegenwärtiger Identität und der Formierung unseres Denkens und Verhaltens zu. Verdichtet gesprochen: Wir als Subjekte werden in starkem Maße geprägt und damit sogar selbst geschaffen. Daraus lässt sich schlussfolgern: Medien, modellieren uns Menschen in ihrem Bewusstsein und ihren Verhaltensweisen in ungemein starker Weise.
Die derzeitige Betonung des Visuellen ist dabei auch kein zufälliges Produkt moderner Informationsgesellschaften. Nein, es ist ihnen zutiefst inhärent, da zunächst einmal die Informationsgesellschaft schon ihres Begriffes wegen Mediengesellschaft ist (insofern, da Informationen lediglich medial zugänglich sind) und andererseits Massenmedien ganz wesentlich ihre Bedeutung aus den Bildmedien ziehen.
Diese These lässt sich unterstützen, wenn wir einen Blick auf den Zusammenhang von Bildverwendung und Mediengesellschaft werfen. Es scheint, als tendieren hochgradig vernetzte Gesellschaften und Organisationen dazu, die Steuerung gesellschaftlich relevanter Abläufe und das Zurschaustellen der eigenen Identität visuell zu vermitteln. Alles unter der Prämisse, dass graphischen Darstellungsmethoden eine überaus große Übersichtlichkeit zugesprochen wird. Wage wird es allerdings, wenn wir mit der Behauptung einen Schritt weiter gehen und die landläufige Meinung übernehmen, dass Bildern eine unmittelbare (freilich nur vorgetäuschte) Verständlichkeit zugeschrieben wird. Damit lässt sich argumentieren, dass die Verwendung von Bildern eine Kompensation, oder besser ausgedrückt, eine Reduktion der durch Vernetzung gewachsenen sozialen Komplexität entgegenwirken könnte und damit auch gleichzeitig den massenweisen Einsatz begründet.
Allerdings geht der soeben unterstellten Unmittelbarkeit der Bildverständlichkeit selbstverständlich nicht über den bloßen Anschein dieser hinaus. Der Trugschluss einfacher Verständlichkeit führt in Folge also direkt zur Gefahr einer manipulativen und ideologischen Qualität des Bildgebrauchs. Wir haben es bei Bildern, ebenso wie bei Sprache, mit einem Vermittlungsphänomen zu tun, über das unser Selbstverständnis und das der Welt kommunikativ geprägt wird. Die Verschiebung der gegenwärtigen Sinnerzeugung von Sprechhandlungen hin zu Zeigehandlungen bedingt also eine Bildkompetenz, die sowohl die Forschung als auch der rezipierende Laie (noch) nicht vollständig aufweisen kann. Die Interpretation bildlicher Darstellung ist äußerst komplex und gelingt oft nur nach der Herausbildung spezifischer Interpretationskontexte samt implizierter Regeln. Im Gegensatz zur sprachlichen Kommunikation liegt es entsprechend nahe, bildliche Kommunikation als implizite Kommunikation zu bezeichnen, die ein inhärente Erfordernis besitzt, die jeweilig verfolgte Absicht in der Bildverwendung zu entschlüsseln. Das Problem dahinter ist nun, dass insbesondere die nicht-arbiträren und somit wahrnehmungsgestützten Medien in der Forschung erst gegenwärtig thematisiert werden. Einen allübergreifenden Theorierahmen scheint es bis dato noch nicht zu geben.
Vollständigkeitshalber sollte nicht unerwähnt bleiben, dass sich, unabhängig einer nicht immer offensichtlichen Komplexität von Bildern, nicht leugnen lässt, dass etwaige Aspekte, die Bildern per se inhärent sind, in einem weit aus stärkerem Maße, als dies etwa bei der natürlichen Sprache gegeben ist, eine über Kulturen hinweg gehende Rezeption erlaubt. Man kann sogar so weit gehen, zu behaupten, dass dies mit einer perzeptuellen Besonderheit der Rezeption zusammenhängt und eine anthropologische Verankerung nahelegt. Es ist nicht zu verkennen, dass dies zunächst ein Widerspruch zu oben genannter These vom Sehen und Wahrnehmen als kulturelles Konstrukt scheinen mag. Dieser Widerspruch lässt sich allerdings auflösen, in dem wir nochmal auf Barthes Rhetorik des Bildes zurückgreifen. Demzufolge beinhaltet jede bildliche Darstellung auch einen denotativen Charakter, eine buchstäbliche Nachricht, die durch das zustande zu kommen scheint, was nach der Ausschaltung sämtlicher konnotierender Elemente übrigbleibt. Eine Tomate ist eine Tomate, nur die Bedeutung der Tomate variiert kulturell bedingt.
Teil 2 im nächsten Artikel.